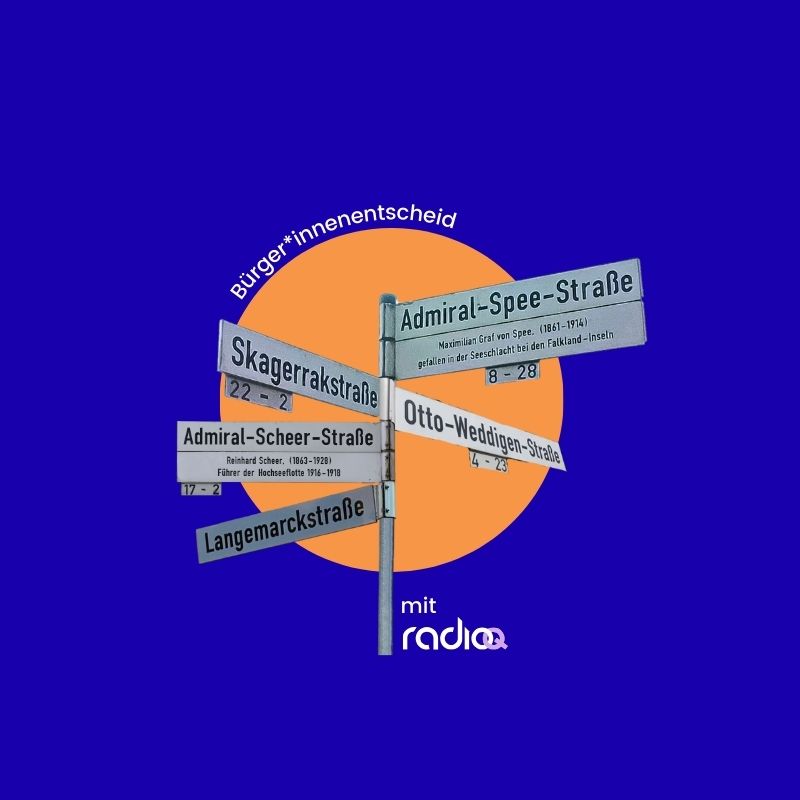Von der Dramaturgie chronischer Erkrankungen und dem visuellen Schreiben – Kay Matter im Interview zu „Muskeln aus Plastik“
Written by Carlotta Aupke, Anika Hagen on 14. November 2025
„Muskeln aus Plastik“ erzählt von chronischer Erkrankung, Transidentität und Crushes. Das erste Prosawerk des Autors Kay Matter hat am 21.11.25 Premiere der Uraufführung am Theater Münster. Unsere Redakteurinnen Anika Hagen und Carlotta Aupke haben Kay Matter im Theater Münster getroffen, um mit ihm über den Text und die Inszenierung zu sprechen.
Q: Wir sitzen hier gerade im Theater Münster mit Kay Matter. Wie geht es dir? Wie war die Anfahrt nach Münster?
Kay Matter: Also leider hat der Zug gebrannt, aber nicht so richtig schlimm gebrannt, aber halt geraucht und man musste dann in den anderen Wagen gehen und das Gepäck zurücklassen und es hat gestunken. Deswegen war ich ein bisschen zu spät zur Probe. Ja, aber die zweite Hälfte konnte ich noch machen.
Q: Schön, dass du jetzt hier bist. Die Uraufführung für das gleichnamige Theaterstück zu deinem Buch „Muskeln aus Plastik“ findet am 21. November hier im Theater Münster statt. Wie kam die Produktion mit genau dem Theater Münster zustande?
Kay Matter: Also wir waren schon länger im Gespräch. Vor ein bisschen über zwei Jahren habe ich mit Remsi Al Khalisi geredet, weil er sich interessierte, oder die ganze Dramaturgie sich interessierte, ein Stück von mir zu machen. Und letztes Jahr wurde hier mein Stück „Helena oder Stay safe and sorry” uraufgeführt, vor einem Jahr ziemlich genau. Und damals war schon die Idee, eine längerfristige Zusammenarbeit anzufangen, und dass ich noch einen Stückauftrag bekommen soll, was zu schreiben, extra hier fürs Theater. Und ich war damals noch so mittendrin im Schreibprozess an dem Buch „Muskeln aus Plastik“ und hatte das Gefühl, ich will daraus auch was für das Theater machen, weil es einfach sehr dazu eingeladen hat und ich ja eigentlich auch vom Theaterschreiben komme und man dann noch mal bei einem Theaterstück andere Sachen machen kann, als in einem Buch und umgekehrt. So ist das zustande gekommen.
Q: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du eigentlich eher Theatertexte schreibst. Vor deinem Prosa-Debüt „Muskeln aus Plastik“ war das ja hauptsächlich deine Textform. Was hat dich dazu bewegt, die Themen chronische Erkrankungen und Transness in einem Prosa-Text zu behandeln?
Kay Matter: Also ich glaube, grundsätzlich habe ich erst mal den Gegenstand oder eine Fragestellung oder sowas und dann sucht sich das meistens die Form. Und da war es einfach auch dem geschuldet, dass ich gar nicht in der Situation war, in der ich hätte wegen Krankheit ins Theater gehen können. Und es war halt gar nicht naheliegend, das an einem Ort zu verhandeln, der für mich selber nicht zugänglich ist in den allermeisten Fällen. Es ändert sich auch langsam ein bisschen und es wird jetzt hier auch ein bisschen anders sein bei der Aufführung von meinem Stück, aber im Allgemeinen ist es schon so. Und ich habe auch erst mal nur so für mich geschrieben. Das war jetzt nicht mit dieser Idee von, das soll dann ein fertiges Produkt sein. Und ich habe einfach vor allem auch sehr viele Texte gelesen. Diese Themen oder Fragestellungen finden sich dann eher wieder in englischsprachiger Non-Fiction als in deutschsprachigen Theaterstücken. Und das war dann auch der Kontext, in dem ich mich bewegt habe, was ich gelesen habe und was ich dann selber auch machen wollte auf Deutsch. Und ich wollte auch ein bisschen das Buch schreiben, was mir selber gefehlt hat in der Zeit.
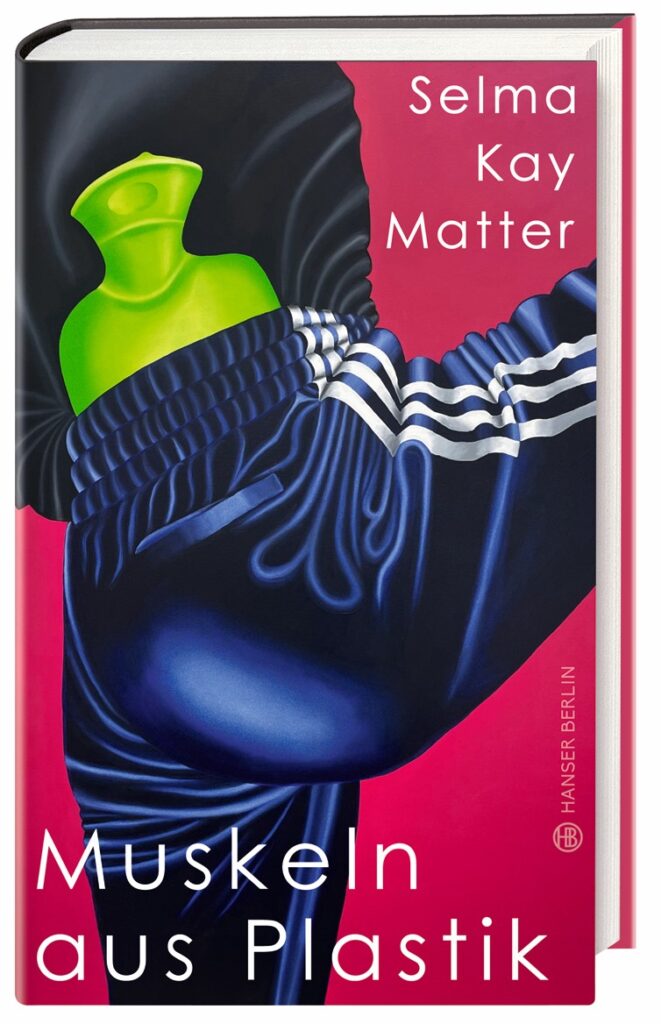
Q: „Muskeln aus Plastik“ ist durch die begrenzten Räume, die detaillierten Beschreibungen und auch die viele wörtliche Rede ein sehr visueller Text. Hattest du beim Schreiben auch schon im Hinterkopf, dass es eine mögliche Inszenierung werden könnte?
Kay Matter: Ja, voll. Es war jetzt nicht die Absicht, aber ich habe das schon währenddessen gemerkt und so kam das auch, dass ich vorgeschlagen habe, daraus ein Stück zu schreiben. Und ich denke schon einfach beim Schreiben immer sehr visuell und sehe immer diese Orte vor mir und so weiter. Und das ist nicht, dass ich mir dann immer die Bühne vorstelle unbedingt, aber eben wie ein Film, der dann auf einer Bühne seine Übersetzung finden würde.
Q: Der Roman beschäftigt sich unter anderem mit dem dramaturgischen Unterschied zwischen chronischen und akuten Erkrankungen. Inwieweit würdest du sagen, nimmt das Einfluss auf die ganze Inszenierung und wie das auf der Bühne dann zu sehen ist? Wir haben ein Zitat aus dem Buch, wo du das beschreibst: „Chronische Erkrankungen haben im Gegensatz zu Unfällen meiner Meinung nach vor allem ein dramatisches Problem. Care und Empathie hält maximal so lange wie ein Gips. Und man weiß doch genau, wie das ist, wenn der Gips irgendwann gräulich und muffig wird und alle schon unterschrieben haben.“
Kay Matter: Ja, es geht ja schon auch in meinem Text unter anderem um Krankheitsnarrative und oft in Büchern und Filmen, wenn es eine Geschichte mit Krankheit geht, dann wird diese Spannung eben darüber hergestellt, dass es Lebensgefahr gibt oder diese Frage, wird alles wieder gut? Und es war natürlich schon eine Frage: Wie findet man eine andere Dramaturgie und auch einen Rhythmus? Ich sage jetzt extra nicht Spannung, weil es geht ja nicht nur Spannung, sondern einen dramaturgischen Rhythmus, wo man dann dranbleibt und der so fließt, der aber nicht über so eine plumpe Frage, die auch ein bisschen vielleicht die Figuren verrät oder hintergeht, funktioniert. Und ich glaube, das sind dann oft so kleinere Bewegungen, so wie sich im Buch die einzelnen Kapitel beziehungsweise Essays zusammenfügen und immer das eine das nächste erforderlich macht. So ist das mit diesen Szenen, würde ich sagen, auch ein bisschen.
Q: Du hast in einem Instagram-Post kritisiert, dass Genre-Bending Literatur im Rahmen von Preisverleihungen kaum bis keine Beachtung geschenkt wird. Dieses Format funktioniert aber bei deinen Texten besonders gut, eben auch bei „Muskeln aus Plastik“. Schafft das Genre-Bending einen Raum, sich mit Themen wie Disability und Transness noch differenzierter auseinanderzusetzen, durch die offene Textform und die ineinandergreifenden Genres?
Kay Matter: Ja, ich würde voll sagen und ich würde auch sagen, der Kontext, vor dem das entstanden ist, oder die Geschichte davon, ist eigentlich auch wichtig. Das Ding ist ja, im deutschsprachigen Raum gibt es dann vor allem Auszeichnungen für Prosa, was auch oft relativ eng begriffen wird, oder Lyrik oder Sachbuch, aber das beides viel weniger. Und es gibt ja wirklich so Warengruppen. Also mein Buch ist jetzt irgendwie in der Warengruppe Essay, dann darf man es nicht einreichen für den deutschen Buchpreis und so Sachen. Also für die meisten Debütpreise darf man das gar nicht einreichen. Und im Englischsprachigen ist das ja viel freier mit Literary Non-Fiction, wo das vielmehr verschwimmt zwischen Prosa, Theorie, Autotheorie, Sachbuch. Und ich liebe diese Formen voll, wo es sich einfach diese Formen sucht, die es braucht, weil das auch ist, wie ich arbeite und was ich gerne lese. Und das andere ist, dass es zum Beispiel im Kontext von Schreiben aus einer behinderten/chronisch-kranken-Perspektive, einfach eine sehr große Tradition von Zines gibt, also von selbstgebastelten kleinen Heften, für die es keinen Verlag braucht und wo man nicht an Gatekeepers vorbei muss. Es gibt ja zum Beispiel dieses Buch, das heißt „Carework – „Dreaming Disability Justice“ von Lea Lakshmi Piapzna-Samarasinha. Ist nicht so lange her, dass es erschienen ist und das war so das erste Buch, wo es wirklich um Disability ging und Theorie, was in einem großen Verlag erschienen ist. Aber auch das arbeitet zum Beispiel voll mit diesem Collagenhaften von Zines, dass man da auch irgendwelche Tipps, eben Reisetipps, rein tut, aber auch Theoriezitate, kann auch eine Zeichnung drin sein. Und ich mag es voll, so zu arbeiten, dass jemand da so ein bisschen offeneres Dokument sozusagen bekommt.
Q: In Muskeln aus Plastik dreht es sich immer wieder die Suche nach einer Sprache für Schmerz. Konnte jetzt rückblickend der Schreibprozess eine gewisse Sprachlichkeit für den Schmerz schaffen?
Kay Matter: Klar, irgendwie schon. Also es ist natürlich immer so, man kommt da nie ganz ran, auch wenn man anfängt theoretisch drüber nachzudenken. Natürlich kann das nie irgendwie abgebildet werden, aber ich finde schon auch im deutschsprachigen Raum wird es ja oft sehr belächelt, wenn Leute, die den Anspruch haben, einen literarisch „wertvollen“ Text zu schreiben, das auch als irgendwie reinigend oder therapeutisch empfinden. Und das ist ja im Englischsprachigen auch voll anders. Ich habe schon das Gefühl, dass das einfach so einen starken Effekt haben kann, etwas dann zu versprachlichen.
Q: Im Buch wird das Konzept des „With-nessing“ von Bracha Ettinger aufgemacht. Dabei geht es eine weniger passive, aber teilnehmende Beobachtung bis hin zu einer geteilten Erfahrung von z. B. Erkrankungen. Daran anschließend stellt die Hauptfigur Kay die Frage danach, wie diese Praxis aussehen könnte. Jetzt auch rückblickend: Konntest du diese Frage in Teilen für dich beantworten oder hast du eventuell konkrete Ansätze oder Wünsche, wie das aussehen könnte?

Kay Matter: Ich glaube, das kommt sehr auf den Kontext an und führt sehr weit, jetzt konkret zu sagen, das muss man tun. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich auch eine ethische und sehr praktische Frage, wie man angemessen auf den Schmerz anderer reagiert und damit umgeht. Und ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, dem erst mal einen Raum zu geben und den nicht sofort wegmachen zu wollen, wenn man es sowieso nicht kann oder so. Also das ist ja auch, was da so in dem Kontext gesagt wird, oder was Sara Ahmed auch schreibt, in dem Moment, wo man das als Ereignis in der Welt zusammen witnessed oder with-nessed, ist es nicht mehr was, womit die Person, die das erlebt hat, so alleine ist. Und das ändert was an dieser Einsamkeit, im besten Fall.
Q: Ich habe mich gerade gefragt, ob das dann vielleicht auch eine Auswirkung hat, das jetzt im Theater live mitzuerleben, auch wenn es dann eben wieder nur von kurzer Dauer ist. Oder wie stehst du dazu?
Kay Matter: Also über dieses Ding von diesem witnessing, also einfach dieser Zeug*innenschaft, was es als Begriff gibt, eben zum Beispiel bei Sarah Ahmed, wo es um Schmerz geht, wie sehr uns das trennt, aber auch so verbindet, oder dieses Potenzial hat. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, als es auch ein bisschen darum ging, was hat mich interessiert daran, daraus ein Theaterstück zu machen. Also mich interessiert natürlich voll diese Ambivalenz von Scham und sich zeigen wollen, zum Beispiel im Kontext von Schmerz und Queerness und Krankheit und dieses: „Ich will, dass man meinen Schmerz sieht, aber man darf ihn auch auf keinen Fall sehen, weil es ist ja auch ein Risiko, den Preis zu geben. Wie wird darauf reagiert?“ Und das ist ja ein Moment, der dann auch passiert zwischen den Figuren, namentlich der Hauptfigur und dem Publikum. Das fand ich halt voll interessant. Welche Rolle kann das Publikum dann einnehmen, wenn eigentlich zu ihm gesprochen wird und es auf einmal ein Gegenüber gibt? Und deswegen ist in meinem Kopf der Text, auf eine Art auch das Stück, so ein Monolog. Also der ist das nicht literarisch von der Form her. Der ist kein Monolog, aber von der Geste her. Ja, und im besten Fall hat das, also natürlich jetzt nicht in der gar nicht fiktionalen Realität, aber so innerhalb der Erzählung hat das natürlich schon auch was Tröstliches irgendwie.
Q: Dein Text ist in vielen Passagen sehr stark theoretisch unterfüttert und trotzdem ist er aber auch, finde ich, durch die Erklärung und die Übersetzung in den Fußnoten und auch durch das Glossar ganz am Ende ein sehr zugänglicher Text und auch sehr barrierearm. War es dir ein Anliegen, den Textinhalt möglichst niedrigschwellig zu halten damit?
Kay Matter: Also ich glaube, es ist voll wichtig, zu sagen, dass man es eh nie schafft, für alle etwas komplett zugänglich zu machen und das auch kein realistischer Anspruch ist, jetzt in Bezug auf meinen Text. Und ich würde sagen, der ist in mancher Hinsicht wirklich sehr barrierearm, in anderer Hinsicht nicht. Also wenn man es gar nicht gewohnt ist, Texte zu lesen und vielleicht auch ein bisschen theoretischere Texte zu lesen, kann das schon anspruchsvoll sein oder man kann vielleicht nicht so viel damit anfangen. Und mir wurde zum Beispiel auch gesagt: „Was ist mit Leuten, die kognitive Behinderungen haben?“ Für die ist es vielleicht einfach echt nicht so zugänglich und nicht so geil. Was ist mit leichter Sprache? Und da war ich so: Voll wichtiger Punkt. Zugleich finde ich, hat das manchmal auch fast sowas Missionarisches, wenn man das Gefühl hat, alle müssen sich dafür interessieren, was man hervorbringt. Vielleicht ist das einfach gar nicht die Zielgruppe und vielleicht interessiert das diese Menschen dann auch einfach nicht und das ist auch okay. Also ich glaube, das sind so unterschiedliche Perspektiven darauf. Aber es war mir schon voll ein Anliegen, dass der möglichst zugänglich ist für Leute, die sich damit beschäftigen wollen und die vielleicht auch irgendwie ähnliche Erfahrungen machen oder so, auch weil ich selber zwar studiert habe, aber nicht wirklich wissenschaftlich studiert habe. Und ich habe keine systematische Bildung, was theoretische Texte angeht. Meine Lektorin meinte zu mir: „Das, was du da machst, ist Critical Theory.“ Und ich war: „Was ist Critical Theory?“ Ich weiß nicht, was das ist, weil ich selber sehr assoziativ gelesen habe und mir dann diese Verknüpfung auch selber erschließen musste. Und deswegen sind diese Fußnoten eigentlich was, was es nicht noch komplizierter, akademischer, machen soll, sondern eher, dass man, wenn man das braucht, die noch bekommt. Das war schon die Idee, auch mit dem Englischen.
Q: Ja, voll. Also sehe ich auf jeden Fall auch in dem Text so. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich: Welche Erwartungen hast du an die Inszenierung und auch vielleicht an die Rezeption von den Gäst*innen?
Kay Matter: Schwer zu sagen. Also ich war ja jetzt schon auch viel in Kontakt mit Jakob Weiss, der das inszeniert, und Victoria Weich ist die Dramaturgin, die das betreut. Wir haben viel gesprochen, deswegen ist es für mich jetzt nicht so eine totale Blackbox und ich kann mir ein bisschen was vorstellen und habe vorhin auch die Fassung gesehen, die die gemacht haben, weil man immer ja noch ein bisschen was anders anordnet oder streicht. Und ich bin neugierig. Ich freue mich. Ich glaube, der Fokus wird einfach – und das interessiert mich auch – mehr auf diesen zwischenmenschlichen Beziehungen der Figuren liegen, als jetzt beim Buch. Beim Buch vielleicht noch mehr auch diese hardcore theoretischen Fragen, denen dann auf den Grund gegangen wird. Also das Stück arbeitet weniger sich daran ab und mehr an dieser Story und sozusagen, was passiert, wenn man die Konflikte auch wirklich alle zu Ende austrägt, die im Buch eher teilweise angerissen werden. Das interessiert mich und auch das ist ja dann trotzdem auch ein vergemeinschaftendes Ereignis, wenn das als Stück gespielt wird. Und Rezeption? I don’t know. Also das ist für mich auch immer schwer zu sagen. Theater ist ja dann doch teilweise sehr lokal. Also dann gucken sich das eher Leute aus Münster an. Kommen auch Leute her? Kann ich nicht so gut einschätzen. Ich glaube, es gibt ja manchmal auch so einen Effekt. Darüber schreibe ich ja auch, wenn man dann über Schmerz schreibt oder da was von zeigt, auch einfach, dass Leute sehr mit so einer Abwehr und einer Wut reagieren. Oder auch mit Queerness, wenn man sich was rausnimmt, was andere sich nicht rausnehmen. Fand ich auch interessant bei dem Stück von einer befreundeten Autorin, Patty Kim Hamilton. Die hat ein Stück geschrieben, das heißt „Schmerz Camp”. Das hatte Uraufführung, ich glaube, vor zwei Jahren in Bremen am Theater. Das ist ein sehr tolles Stück und es geht um chronische Schmerzen. Und da zum Beispiel wurde das ganz schön gebasht von Medien, Zeitungen, in Kritiken. Und da war dann aber oft der Kritikpunkt, dass es zäh ist und langwierig, stellenweise. Aber es ist natürlich genau, worum es geht. Die Leute haben schon auch keinen Bock. So funktioniert schon auch Ableism. Leute haben keinen Bock, sich so mit ihrer eigenen Gebrechlichkeit, Endlichkeit und so auseinanderzusetzen. Deswegen, let’s see.
Q: Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das Theaterstück wird. Ganz lieben Dank für deine Zeit und für die tollen Antworten.
Kay Matter: Danke euch.
Den Spielplan für „Muskeln aus Plastik“ findet ihr unter der Website des Theaters Münster.
Und hier geht’s zur offiziellen Playlist zum Buch:
Autoren
Author
Carlotta Aupke
You may also like
Continue reading